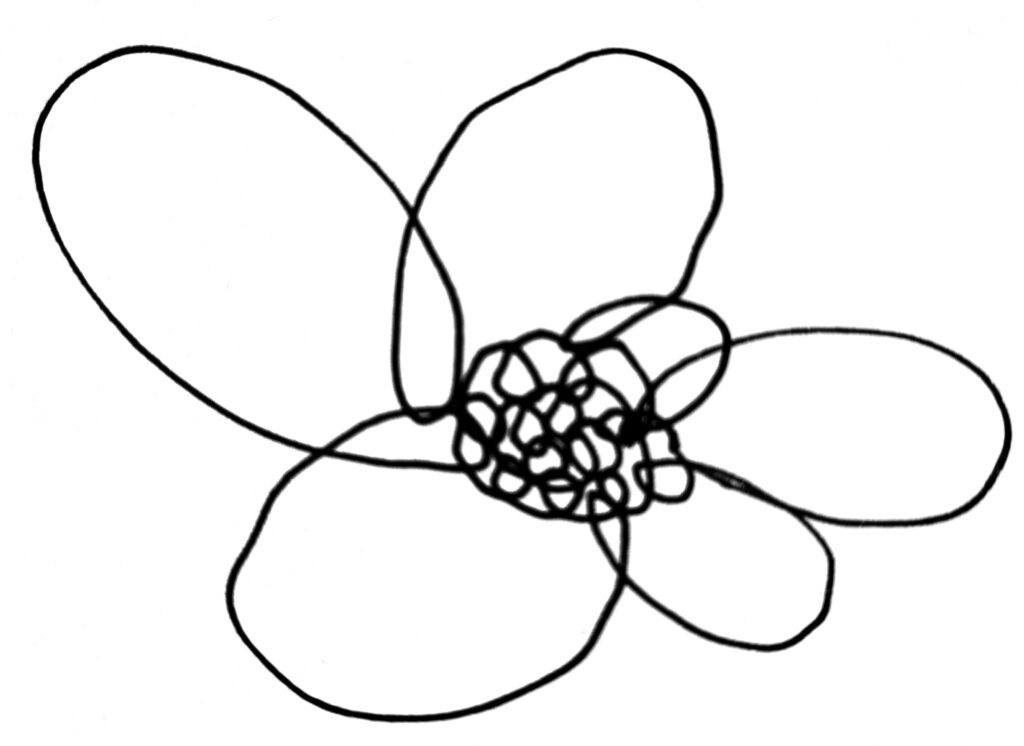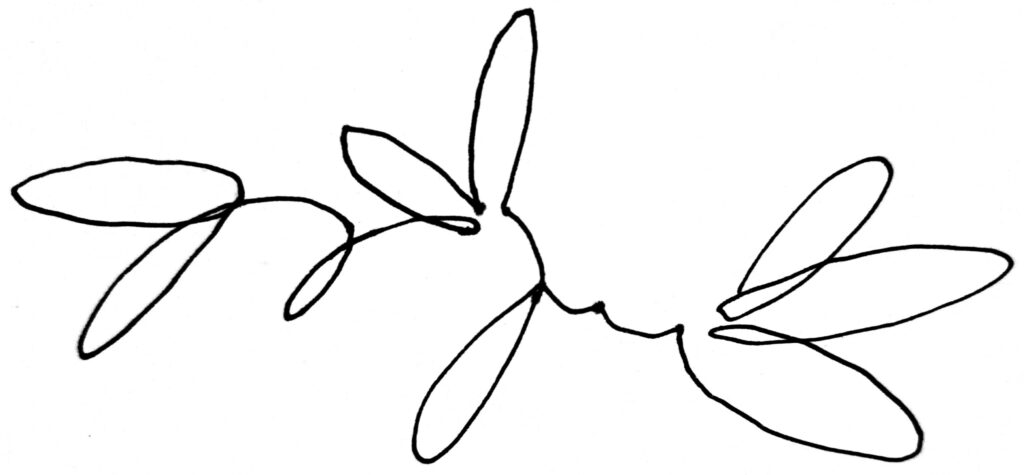Wenn du deine Spielweise umstellst, dann bist du erstmal vor allem eins: dir selber fremd. Und diese Fremdheit ist eine Mehr- Komponenten- Fremdheit. Zwei Aspekte davon:
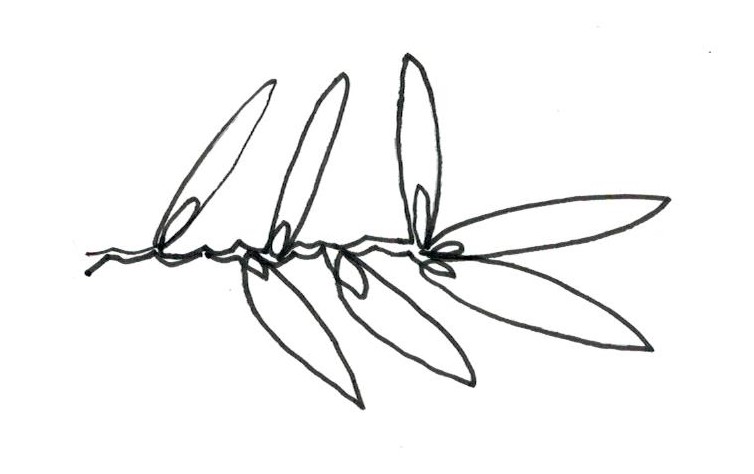
Fremdheit 1 – Augen
Hast du als Kind gern durch Schlüssellöcher geguckt? Dann mach es nochmal, jetzt gleich. Ich wette, du hast nicht vergessen, wie es geht. Und jetzt: guck mit dem anderen Auge hindurch. Ungewohnt? Ja, es ist ungewohnt. Wenn du wie die meisten Menschen bist, dann hast du ein Schlüsselloch- Auge, mit dem du guckst, und ein anderes, das du dabei zukneifst. Das Schlüsselloch- Auge kannst du auch dein Lieblingsauge nennen.
Beim Geigespielen wurde früh für dich festgelegt, dass dein linkes Auge näher am Instrument ist und über Steg, Saiten und Schnecke hinweg auf die Noten schaut, während das rechte Auge weiter davon entfernt bleibt. Der Unterschied in der Entfernung ist klein, aber er gibt deinem Körper eine Richtung an, eine Blick- Richtung. Änderst du deine Spielweise, kehrt sich deine Blickrichtung um, denn dann liegt das Instrument im anderen Arm. Nun liegt das rechte Auge nah zum Steg, überblickt die Saitenlage und folgt der Schnecke bis zum Notenbild. Es fühlt sich an, wie mit dem anderen Auge durchs Schlüsselloch zu gucken. Probiere es aus.
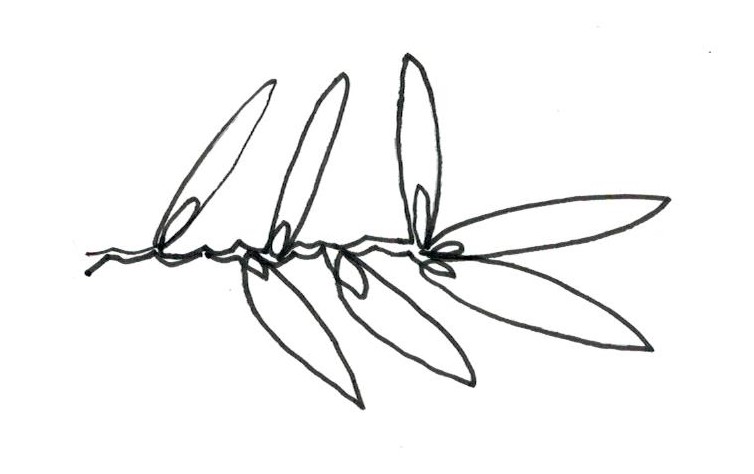
Fremdheit 2 – Ohren
Mit welchem Ohr lauschst du an einer Meerschnecke, die du am Strand gefunden hast, ob du das Rauschen der Tiefsee darin hören kannst? Auch unsere Ohren sind nicht zwei identische Ohren. Eines davon hört früher und lieber bestimmte Frequenzen. Du kennst das vom Hörtest beim Ohrenarzt.
Beim Geigespielen liegt das Instrument am Hals oder Schlüsselbein an, und zwar bei rechtshändiger Spielweise an der linken Körper- und Gesichtshälfte. Dein Ohr hat auf dieser Seite allernächsten, unmittelbaren Kontakt zum Instrument, so wie deine Knochen und Muskeln hier unmittelbarer als am restlichen Körper die Schwingungen des Instruments aufnehmen.
Drehe deine Spielrichtung um, und du hast eine neue Körperhälfte, die diese Art von Kontakt mit dem Klangholz noch nicht kennt; du hast ein neues Ohr, das erst noch das Hören so nah am Instrument lernen muss.
Du klingst nicht wie vorher; du bist nicht mehr dieselbe Musikerin.
Sei darauf vorbereitet, dass dein Klang unerhört sein wird.
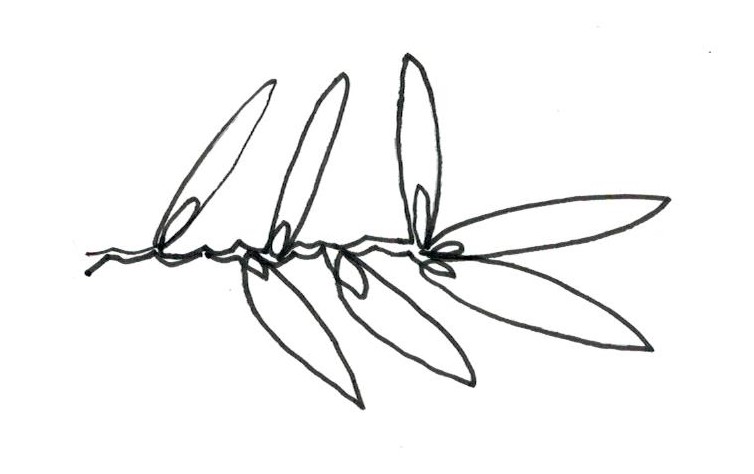
Zusätzlich dazu hört dein „neues“ Ohr auch noch einen neuen Klang, den es vorher im Zusammenhang mit dir noch nicht gegeben hat. Denn du klingst nicht wie vorher; du bist nicht mehr derselbe Musiker, dieselbe Geigerin wie die, die vorher mit dem rechten Arm gestrichen hat. Du wärest kein Musiker, wenn du nicht wüsstest, dass alle Anteile von dir im Klang hörbar sind, nicht nur Tonhöhe und Dezibel. Sei also darauf vorbereitet, dass dein Klang in mehrfacher Hinsicht unerhört sein wird. Gib dir Zeit, ihn hören- und kennenzulernen.
Es ist wahrscheinlich, dass du zu allem Überfluss an Fremdheit auch noch auf einem neuen, anderen Instrument spielst als vorher. Entweder, du hast ein Instrument, das dir schon gehörte, „auf links“ umbauen lassen oder du hast ein ganz neues, linkshändig eingerichtetes Instrument für dich gefunden. Ein ungewohntes Instrument am ungewohnten Ohr unter ungewohntem Auge, zusätzlich zu allem, was Gehirn und Nervenbahnen gerade in die Waagschale werfen, um es neu zu programmieren- noch Fragen?