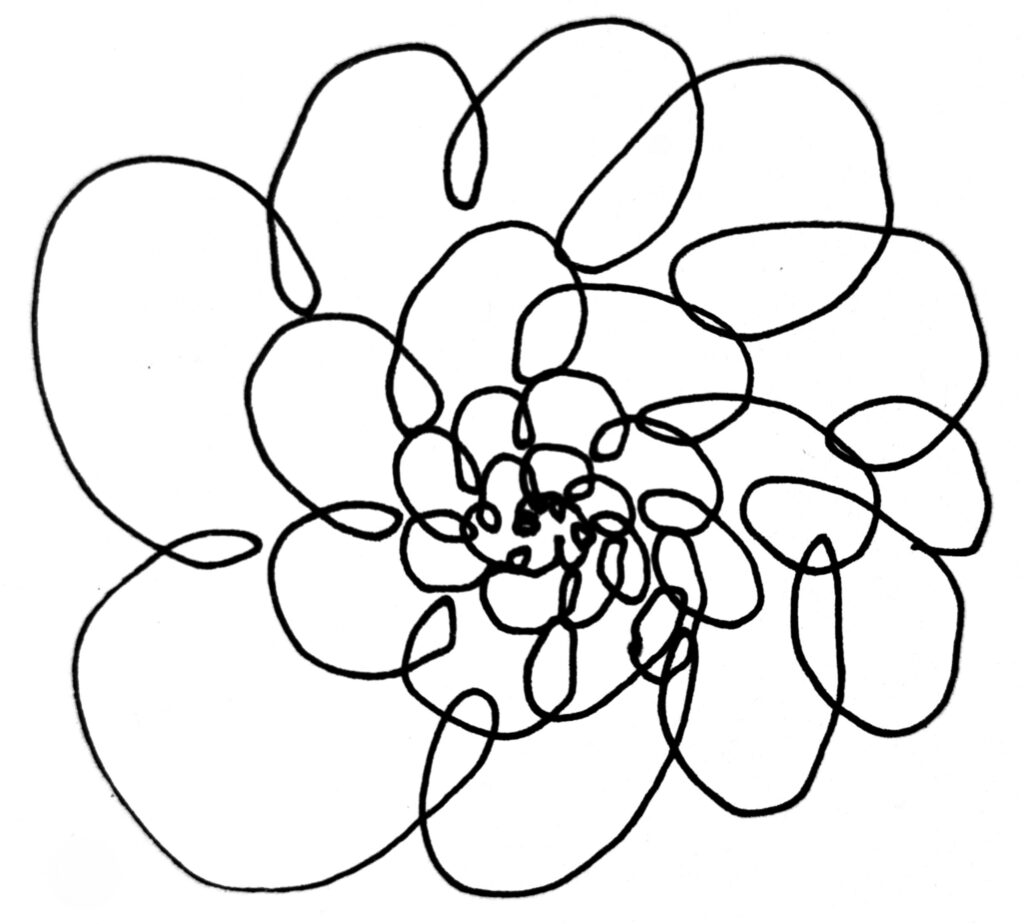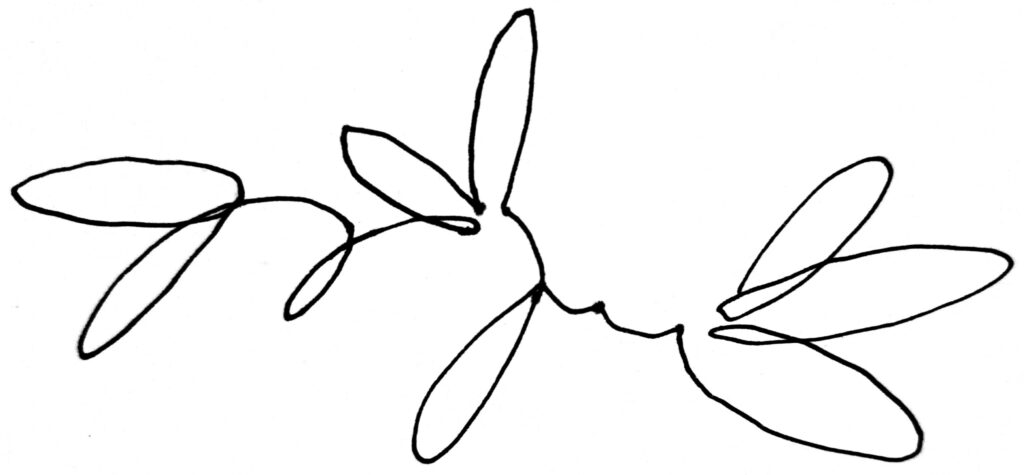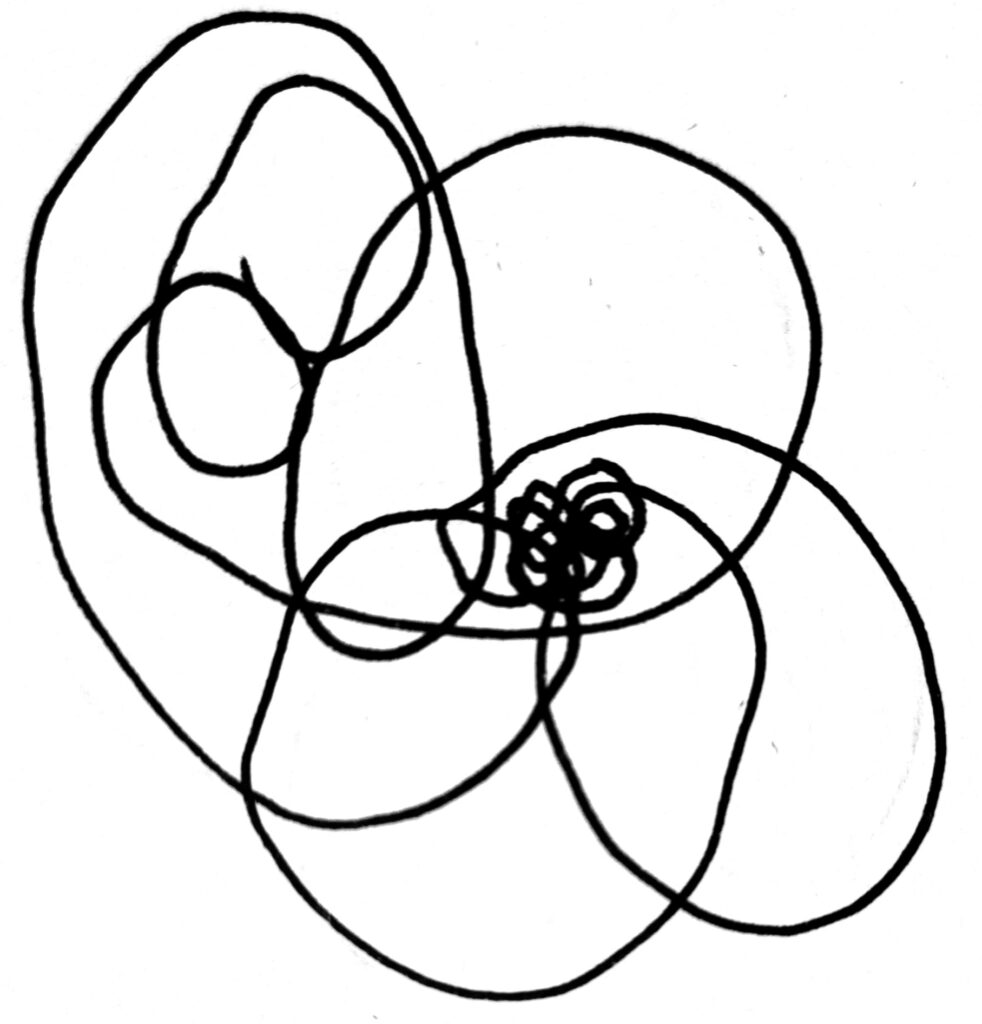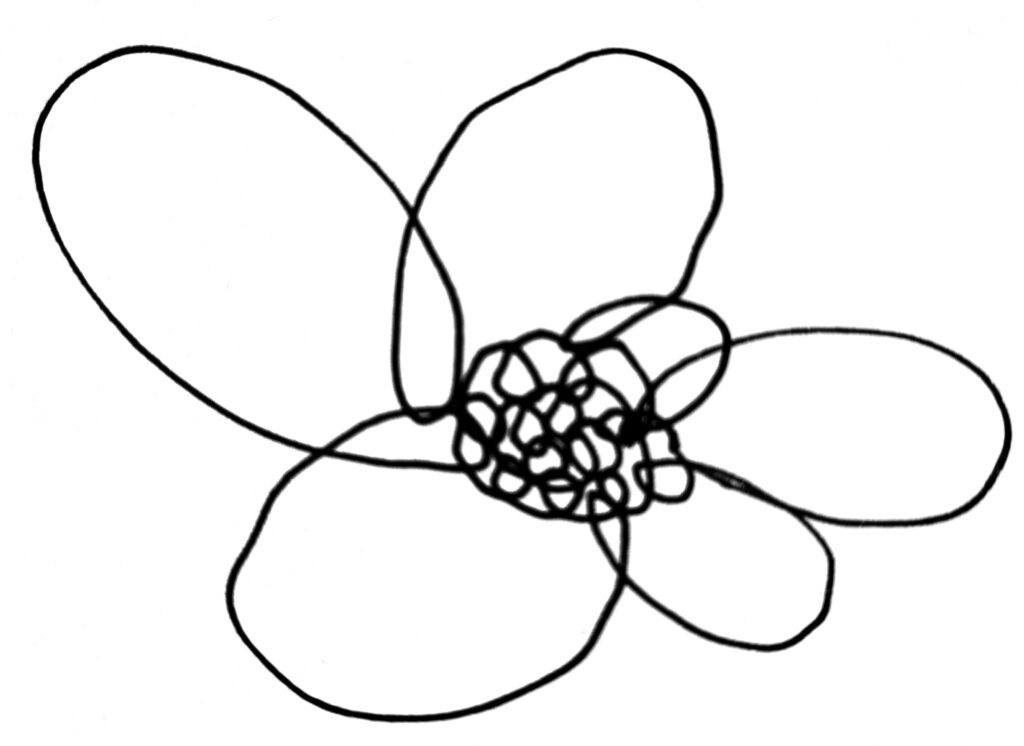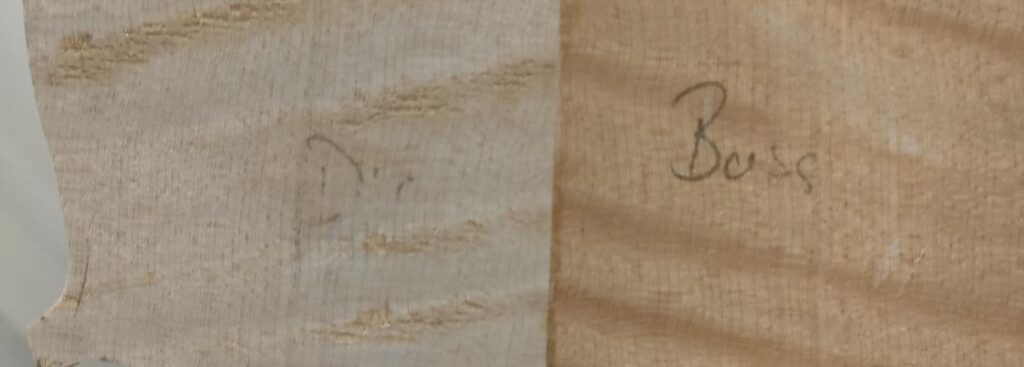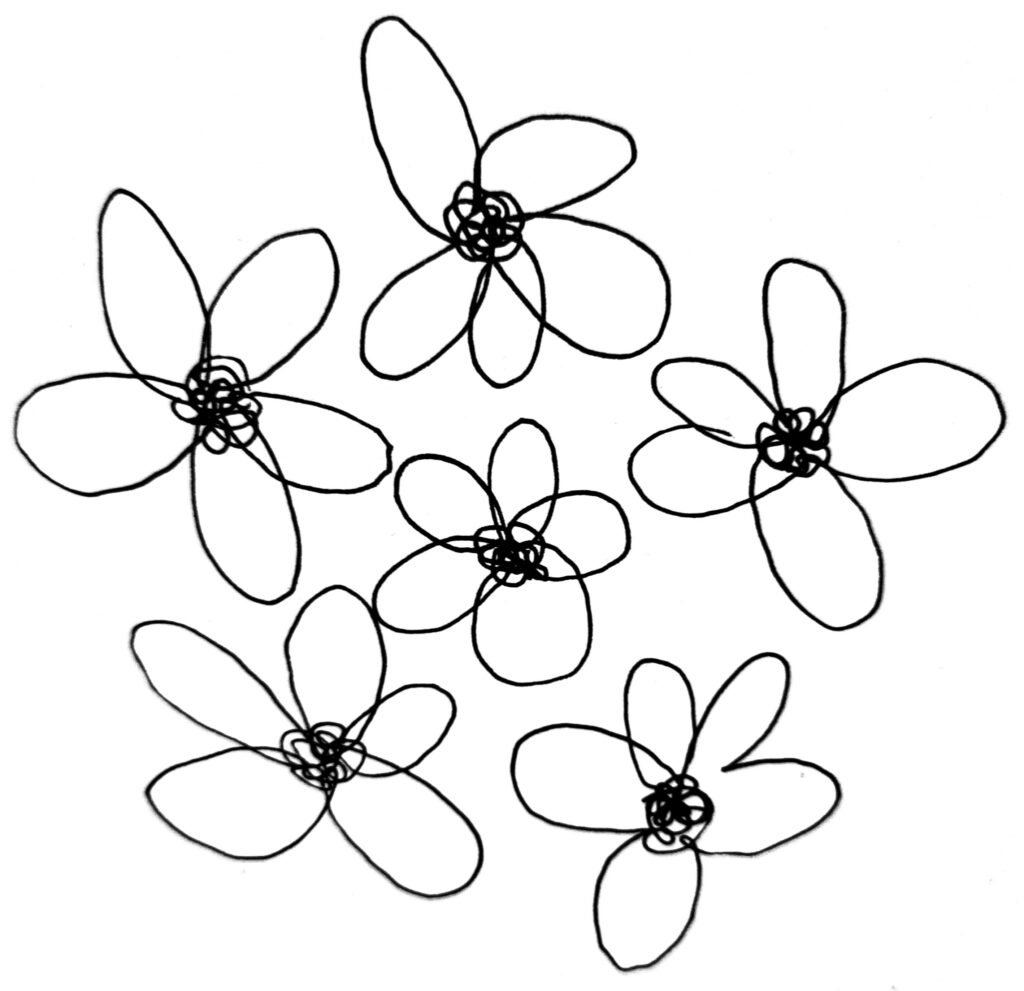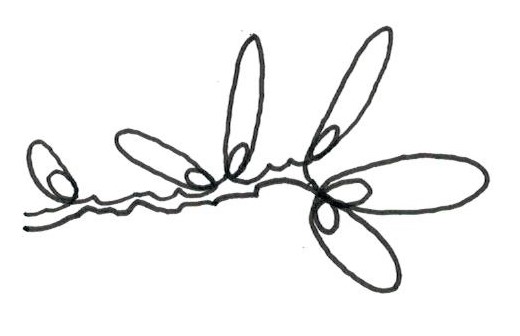Mit Ende 20 entdeckte ich durch Zufall meine Linkshändigkeit, und eine Forschungsreise begann. Kneten wie im Kindergarten, Schwungübungen mit Wachsmalstiften, Tuschen und Zeichnen, schließlich Schreiben mit der linken Hand- alles war neu und aufregend schön. Besonders das Schreiben mit links setzte Informationen frei, die mir bisher über mich selbst verborgen gewesen waren. Ich wurde zwar kein neuer Mensch, aber ich merkte doch, dass der Mensch, der ich war, von innen her eine andere Form annahm, eine deutliche Gestalt.
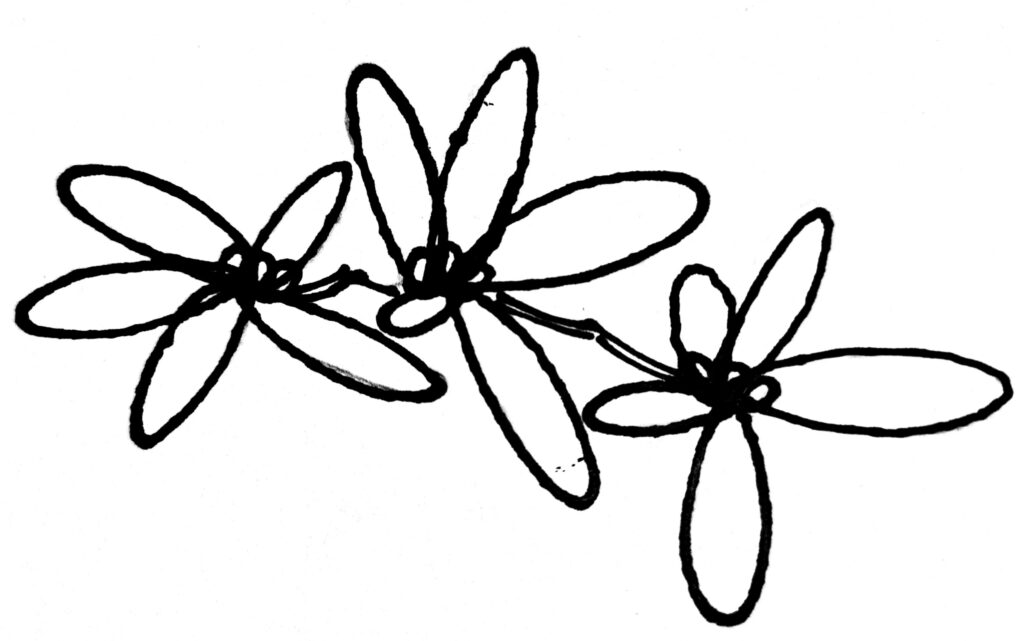
Nach einiger Zeit probierte ich natürlich auch aus, mit links Geige zu spielen- das war im Jahr 2009. Und siehe da- das Empfinden im Bogenarm war ein anderes als mit rechts. Nach diesem grundigen, satten Bogenstrich, der tief in der Saite liegt und nicht nur über sie hinwegzieht, hatte ich immer gesucht. Fasziniert übte ich weiter. Zunächst waren nur 2 -3 Minuten am Tag möglich, denn im Gehirn startete jedes Mal ein Funkenflug und Schneegestöber, mit denen Vorsicht geboten war. Bald konnte ich die Dauer langsam erhöhen und mit dem Aufsetzen der rechten Hand beginnen.
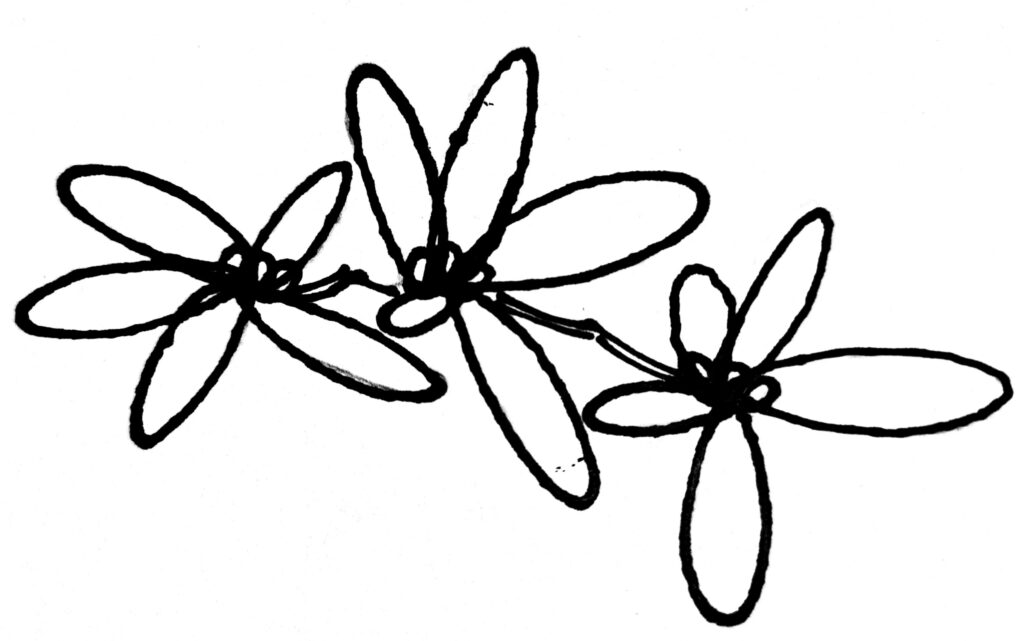
Dann, es war ungefähr 2010, arbeitete ich mit befreundeten Musikerinnen, besonders aber mit Hilfe der Dispokinese, einer speziellen Körperarbeit für Musiker, das Streichen auf beiden Seiten nochmals auf. Denn jeder weiß: einen neuen Bewegungsablauf, eine neue Fertigkeit gleich welcher Art zu lernen, ist immer schön und beflügelnd. Und ich wollte verhindern, dass ich mich von dem spontan sehr guten Gefühl des Linksstreichens und von den ersten Erfolgen zu vorschnellen Entscheidungen treiben ließ. Im Laufe der Arbeitseinheiten mit den erfahrenen Dispokinetikerinnen Anna Kuwertz (Freiburg) und Corinna Hildebrand (Bremen), Letztere meine Kollegin und Freundin, bestätigte sich, was ich bereits geahnt hatte: dass es da etwas gab, ein letztes Quentchen von Ton- und Körperqualität, das ich mit links schon besaß und mit rechts auch nach 20 Jahren Spielpraxis nicht erreicht hatte.
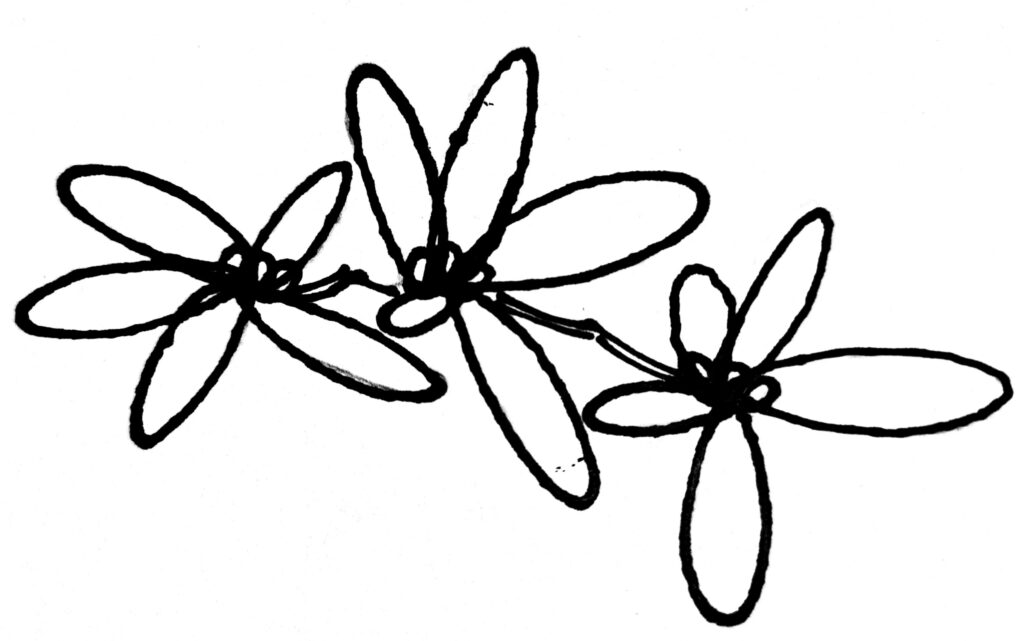
Und so entschied ich mich, umzulernen. Quasi ohne Übergang erschien ich bei der nächsten Mugge (einer einfach besetzten Bachkantate in Lilienthal bei Bremen, 2011) mit dem Instrument in der anderen Hand. Schnell war ich im Stande, die gewohnte Literatur in den gewohnten Ensembles, jetzt eben anders herum, zu spielen. Doch der Umlernprozess forderte enorme Anstrengungen, die größtenteils nur für mich selber wahrnehmbar waren. Was folgte, war eine lange, eine sehr lange Durststrecke.
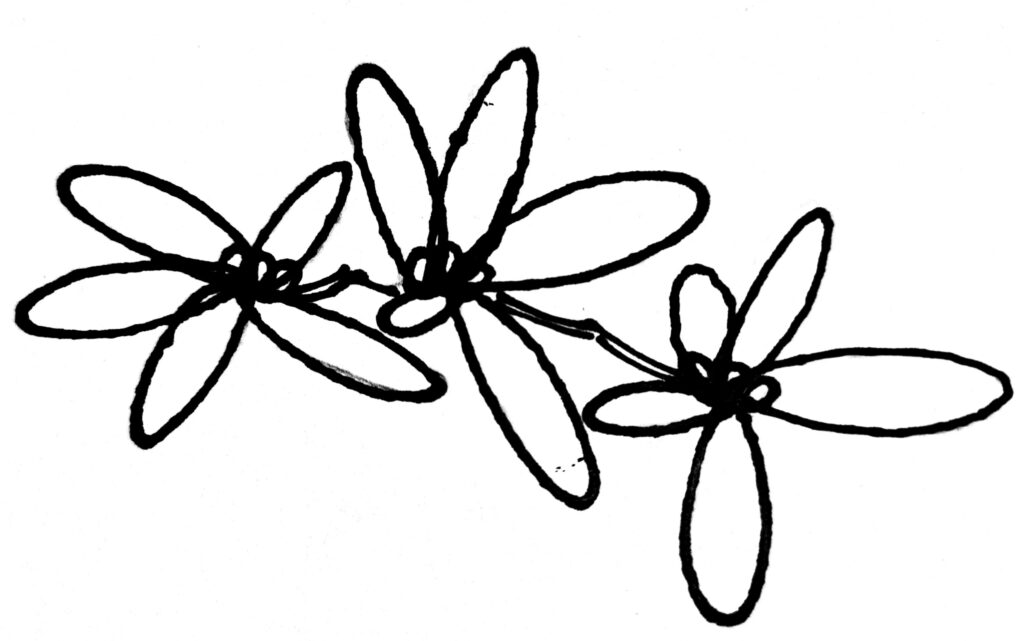
Und so lange hat es gedauert, bis ich eine Tonleiter nicht nur korrekt pitchen, sondern wieder so wie ich wollte intonieren, also einfärben konnte: 2-3 Jahre. Bis ich die barocken Springbögen nicht nur abheben, sondern auch ganz sicher wieder auf die Saite zurückführen konnte: 3-4 Jahre. Bis ich in einem Orchester wieder ohne Angst den Stimmton von der Konzertmeisterin abnehmen konnte, und ich meine die Angst, die befürchtet, dass die rechte Hand den Wirbel nicht richtig im Griff haben könnte: 5-6 Jahre.
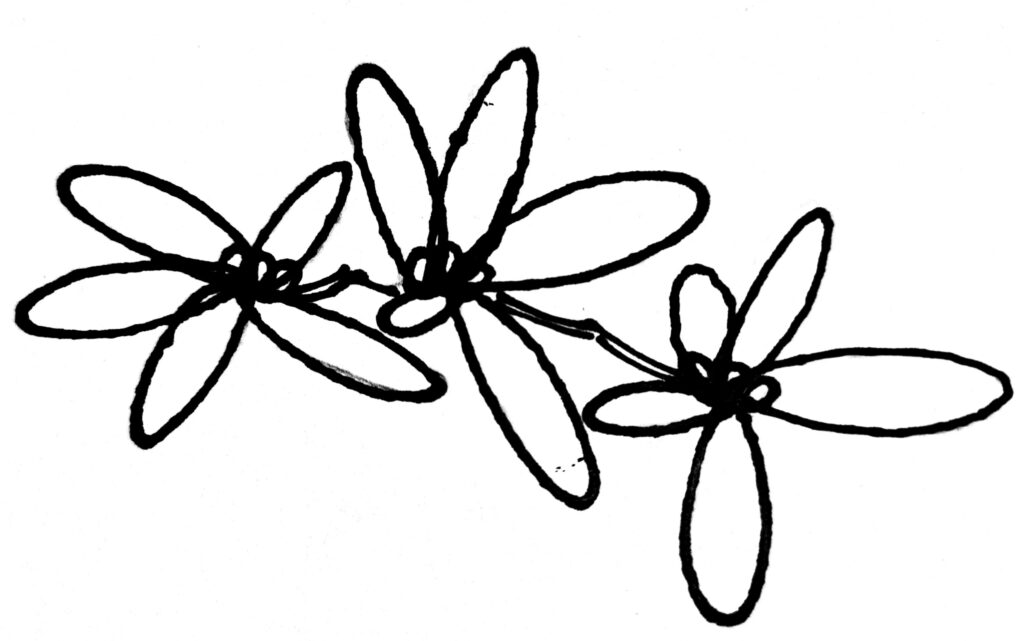
Mir ist vieles passiert, was ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche: In Händels Messias ist mir in einer Generalpause der Bogen auf die Saite gefallen, weil ich eben doch noch nicht wieder die volle Kontrolle hatte. Und ja, Wirbel sind abgestürzt, weil die rechte Hand das Stimmen erst lernen musste. Wirbel stürzen auch so manchmal ab, aber die Angst, den Vorgang nicht unter Kontrolle zu bekommen, erschien während des Umlernens vergrößert wie durch ein riesiges Brennglas.
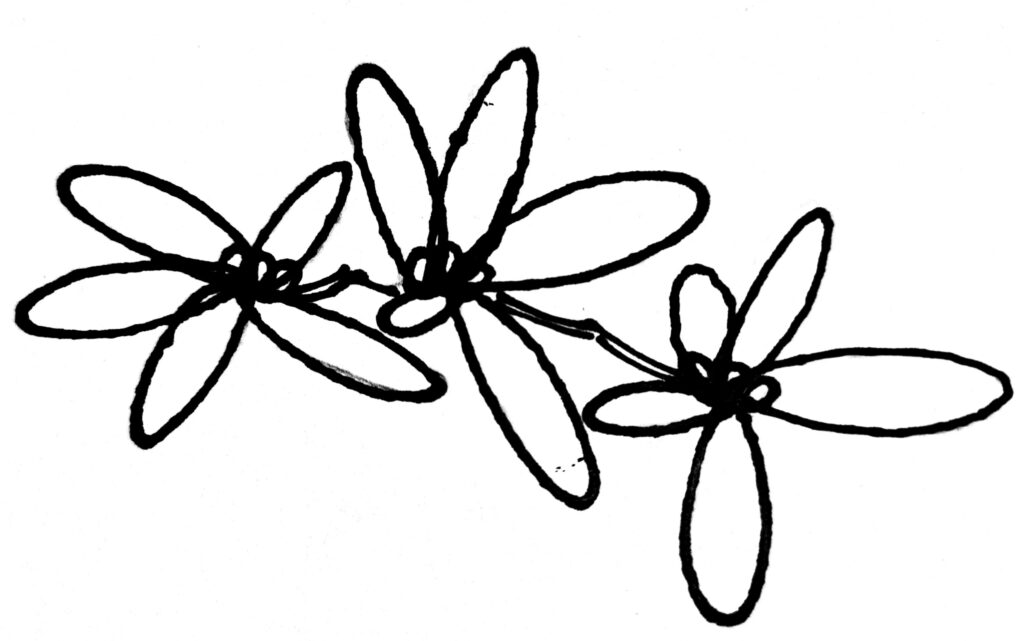
Und immer wieder habe ich geprüft, ob dieser Weg die Mühen wert war: so habe ich einmal eine Saison lang (das war 2012) wieder rechtsherum gespielt, eine ganze Serie von Projekten, denn ich wollte sehen, ob ich es nicht trotz aller Erkenntnisse bei dieser einfacheren Wahl belassen und meinen musikalischen Weg trotzdem weiter zufrieden gehen könnte. Das Ergebnis war: ich verabschiedete mich endgültig vom rechtshändigen Spiel und ließ alle meine Instrumente umbauen bzw. verkaufen, und diese Entscheidung ist gültig bis heute.
Schon an anderer Stelle habe ich geschrieben: ich wünsche niemandem, diesen Weg gehen zu müssen. Ich aber wollte ihn gehen, und: ja, ich würde es wieder tun!